Wenn von „Weltreligionen“ die Rede ist, klingt das zunächst neutral: Man meint die großen Religionen, die auf der ganzen Welt verbreitet sind. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass der Begriff alles andere als unschuldig ist – und in interreligiösen Begegnungen sogar mehr trennt als verbindet.
Woher der Begriff kommt
Der Ausdruck „Weltreligionen“ entstand im 19. Jahrhundert, einer Zeit, in der europäische Gelehrte Religionen nach wissenschaftlichen Kriterien ordnen und vergleichen wollten. Als Maßstab galten: viele Anhänger:innen, weite geografische Verbreitung und vor allem schriftlich fixierte Lehren. In diese Kategorie passten Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Religionen ohne „heilige Bücher“, ohne Mission oder ohne globalen Anspruch – etwa indigene Traditionen – wurden ausgeschlossen.
Schon hier wird sichtbar: Die Kriterien spiegeln ein stark europäisch geprägtes Denken wider und nicht die Selbstsicht der jeweiligen Religionen.
Ein Begriff, der spaltet
Wer von „Weltreligionen“ spricht, teilt Religionen unbewusst in Klassen ein:
„Wichtig“ vs. „unwichtig“ – manche Religionen erscheinen relevant, andere nebensächlich.
„Echt“ vs. „nicht echt“ – nur die „großen“ Religionen gelten als „vollwertige“ Religionen, andere werden als Aberglauben oder Folklore abgetan.
Damit schafft der Begriff eine Hierarchie, die viele Gemeinschaften marginalisiert.
Kritik aus der Religionswissenschaft
Heute sehen viele Forscher:innen den Begriff kritisch. Er sei nicht nur ungenau, sondern auch normativ – also wertend. Statt die Vielfalt religiöser Wirklichkeiten abzubilden, verengt er den Blick auf wenige „große Systeme“. Er ist also eher ein Produkt westlicher Wissenschaftsgeschichte als eine treffende Beschreibung der religiösen Landschaft der Welt.
Warum er im Dialog nicht hilft
Gerade im interreligiösen Dialog ist der Begriff „Weltreligionen“ fehl am Platz. Wenn nur bestimmte Religionen eingeladen werden, andere aber nicht, entsteht keine echte Begegnung auf Augenhöhe. Das Ziel des Dialogs – Respekt und Verständigung zwischen allen spirituellen Wegen – wird untergraben.
Darum setzen viele interreligiöse Netzwerke inzwischen auf inklusivere Formulierungen. Statt von „Weltreligionen“ sprechen sie von Religionen, spirituellen Traditionen oder Glaubenswegen – ohne Wertung, ohne Hierarchie.
Fazit
Der Begriff „Weltreligionen“ stammt aus einer Zeit, in der Religionen in ein starres Schema gepresst wurden. Er spaltet in „groß“ und „klein“, „echt“ und „unecht“ – und ist damit alles andere als hilfreich. Wer Vielfalt ernst nimmt, sollte ihn meiden und nach einer Sprache suchen, die alle religiösen Traditionen auf Augenhöhe sichtbar macht.
Grundlegende Werke zur Kritik am „Weltreligionen“-Modell
- Wilfred Cantwell Smith (1962): The Meaning and End of Religion.
Smith zeigt, dass Begriffe wie „Religion“ oder „Weltreligion“ Konstrukte der modernen Wissenschaft sind, die den gelebten Glauben nicht angemessen wiedergeben.
- Tomoko Masuzawa (2005): The Invention of World Religions: Or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism. Chicago.
Eine grundlegende Analyse, wie der Begriff „Weltreligionen“ im 19. Jahrhundert aus europäischem Universalismus entstand und wie er bis heute koloniale Denkweisen fortschreibt.
- Hans G. Kippenberg (2002): Die Entdeckung der Religionsgeschichte. Religionswissenschaft und Moderne. München.
Zeigt auf, wie die Religionswissenschaft im 19. Jahrhundert Religionen hierarchisierte und dabei das Konzept der „Weltreligionen“ etablierte.
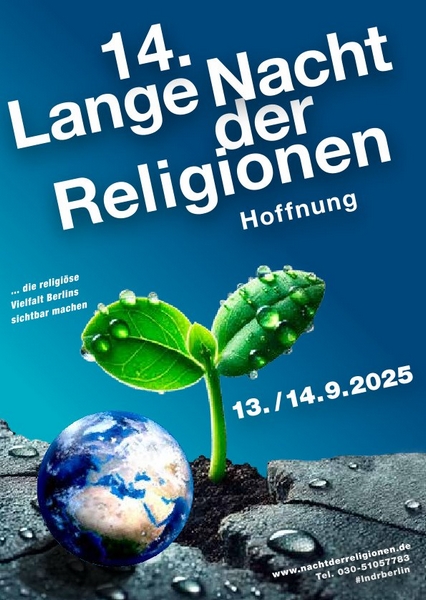
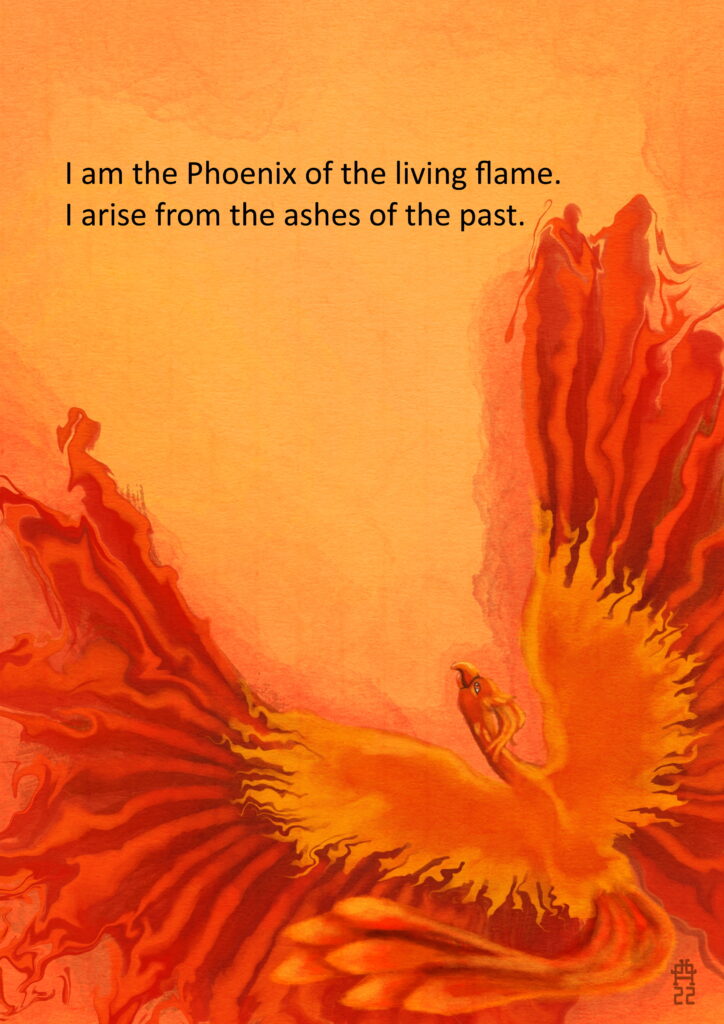

Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.