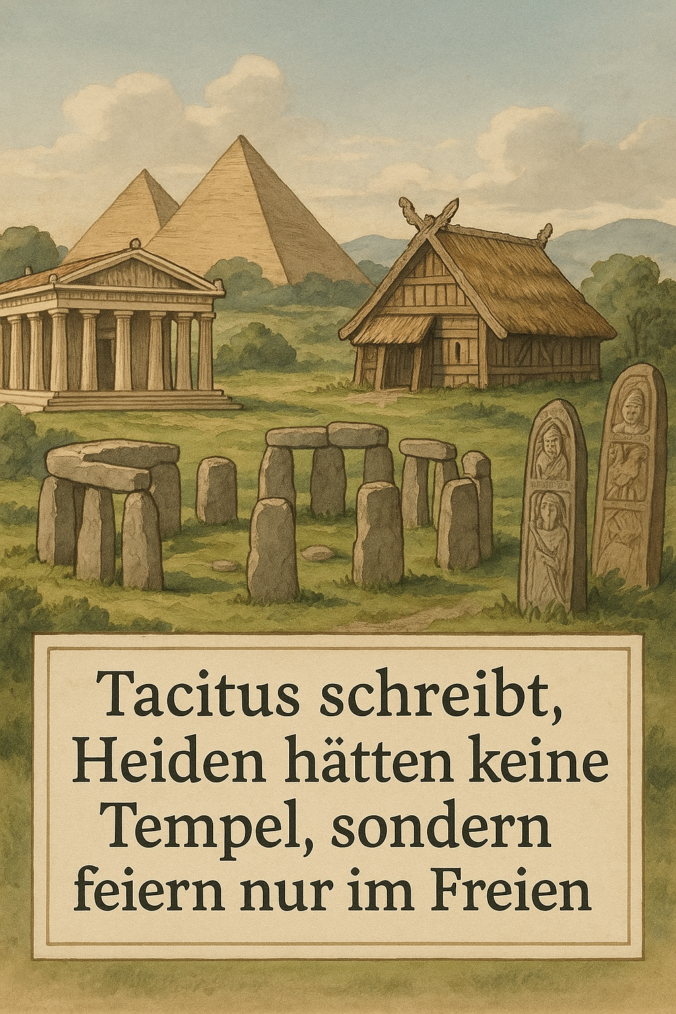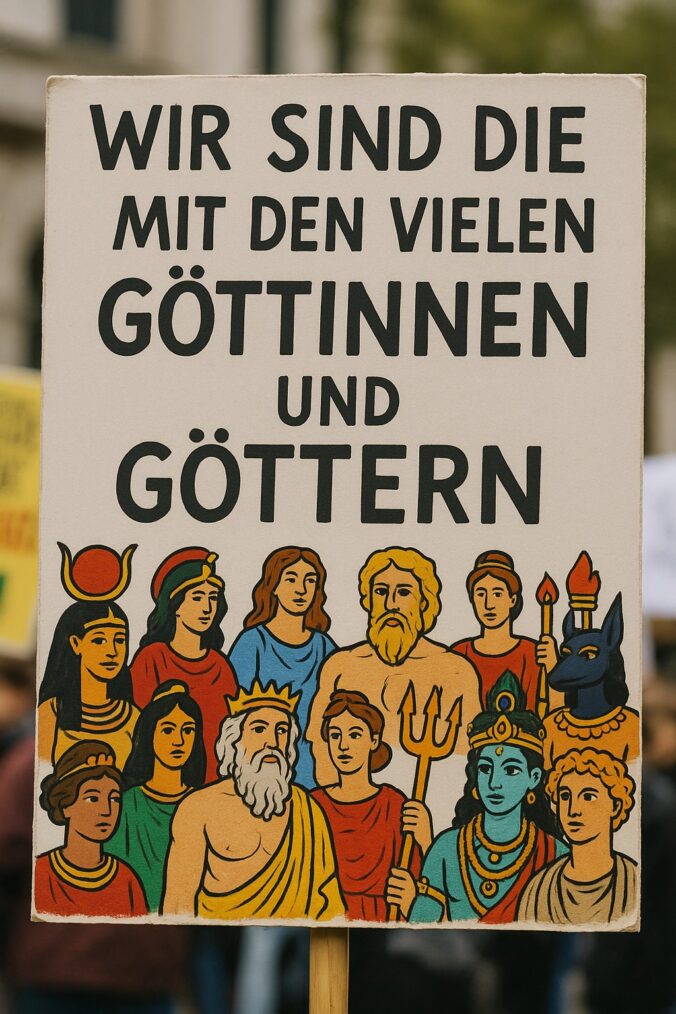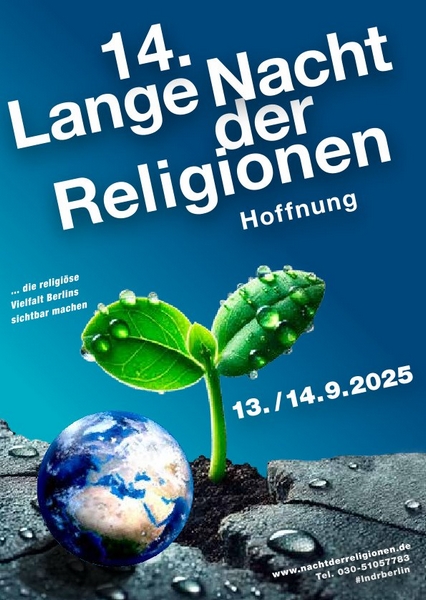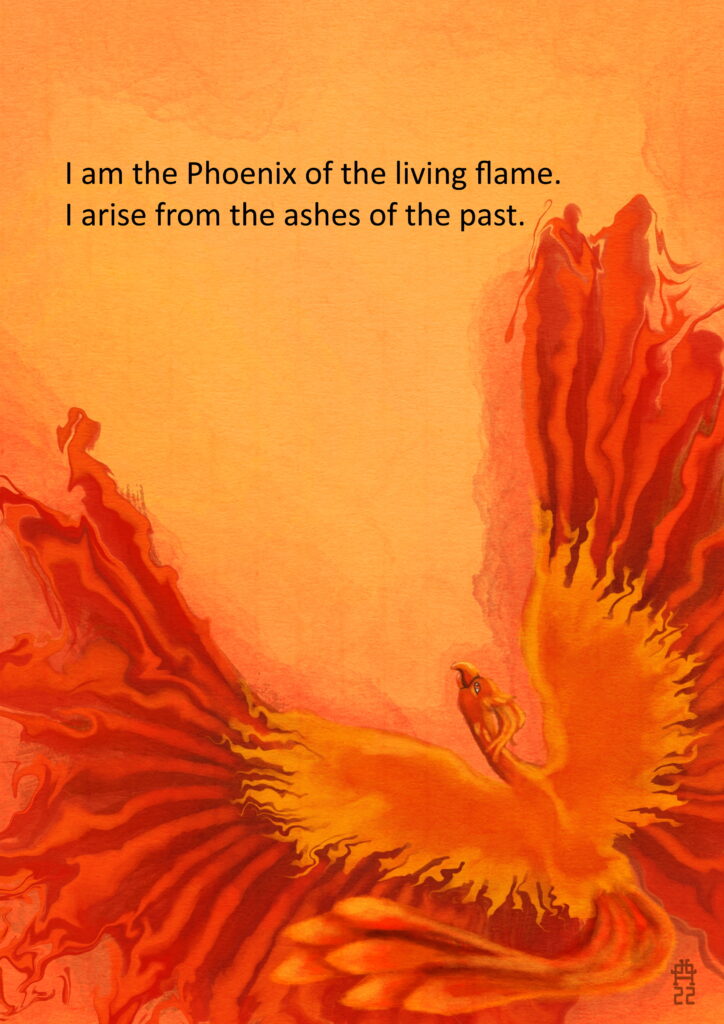Wer sich mit modernem Heidentum beschäftigt, stößt schnell auf Zitate antiker Autoren: Tacitus, Cäsar oder die Edda gehören zum festen Repertoire. Doch warum spielt Schriftliches eine so große Rolle – und warum geraten archäologische Funde, die ja oft direkter aus der heidnischen Vergangenheit stammen, dabei in den Hintergrund?
Die Autorität der Schrift
Im 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert, als sich die ersten Strömungen des modernen Heidentums herausbildeten, waren die Maßstäbe von Wissenschaft und Religion stark textzentriert. Geschichtsschreibung, Theologie und Religionswissenschaft bauten auf Dokumenten, Chroniken und Überlieferungen auf. Wer über Religion sprechen wollte, brauchte Texte.
Das Christentum, Judentum und der Islam konnten auf „heilige Bücher“ verweisen. Heidnische Traditionen dagegen galten als „schriftlos“ – und damit als unbewiesen oder unzivilisiert. Um sich in diesem Diskurs behaupten zu können, griffen moderne Heiden zu dem, was verfügbar war: den Texten von Außenstehenden, die über das Heidentum berichteten. Tacitus’ Germania oder Snorris Edda wurden so zu zentralen Referenzen.
Archäologie: die schwierige Schwester
Natürlich gab es auch Funde: Kultplätze, Grabbeigaben, Mooropfer. Doch diese archäologischen Zeugnisse ließen sich lange Zeit nur schwer eindeutig deuten. Was ist ein Heiligtum, was ein profaner Platz? Welche Objekte sind rituell, welche schlicht alltäglich?
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein fehlte eine ausgefeilte Methodik, um Religion aus Funden zu rekonstruieren. Texte wirkten klarer, „verlässlicher“ – auch wenn sie oft christlich oder römisch gefärbt waren. Erst die moderne Religionsarchäologie hat gezeigt, wie sehr Artefakte, Landschaften und Opferstätten zur Rekonstruktion heidnischer Praxis beitragen.
Auseinandersetzung mit Buchreligionen
Die Orientierung am Schriftlichen hängt eng mit der Auseinandersetzung mit Buchreligionen zusammen. Moderne Heiden standen unter dem Vorwurf, ihr Glaube sei „quellenlos“ oder „erfunden“. Der Rückgriff auf Tacitus und andere Autoren war deshalb mehr als bloßes Interesse an Geschichte: Er war eine Legitimationsstrategie.
„Wir haben Texte – also haben wir Tradition“, lautete die Botschaft.
Heute: Texte und Funde
Inzwischen hat sich die Lage gewandelt. Religionsarchäologen wie Neil Price (Children of Ash and Elm, 2020) oder Rudolf Simek (Religion und Mythologie der Germanen, 2014) betonen, dass die materiellen Spuren ein viel komplexeres, oft widersprüchliches Bild ergeben als die alten Texte. Und Religionswissenschaftler wie Ronald Hutton (The Triumph of the Moon, 1999) oder Michael Strmiska (Modern Paganism in World Cultures, 2005) zeigen, dass moderne Heiden heute beides tun: sie beziehen sich weiterhin auf Texte, öffnen sich aber immer stärker auch für archäologische Deutungen.
Fazit
Ja – es lässt sich wissenschaftlich belegen, dass die starke Orientierung moderner Heiden an Schriftquellen mit dem Wettstreit um Autorität im Vergleich zu Buchreligionen zusammenhängt. Texte boten scheinbare Sicherheit und Reputation. Archäologische Funde rückten erst später ins Zentrum, als die Methoden ihrer Interpretation gereift waren.
Die Zukunft dürfte in einer Balance liegen: Texte und Funde ergänzen einander. Beide zusammen eröffnen ein reiches Panorama des alten Glaubens – und damit auch neue Inspiration für modernes Heidentum.
Literaturhinweise:
- Hutton, Ronald (1999): The Triumph of the Moon. Oxford.
- Strmiska, Michael (Hg.) (2005): Modern Paganism in World Cultures. Santa Barbara.
- Simek, Rudolf (2014): Religion und Mythologie der Germanen. Darmstadt.
- Price, Neil (2020): Children of Ash and Elm. New York.
- Ellis Davidson, Hilda (1990): Gods and Myths of Northern Europe. London.